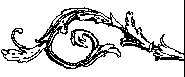
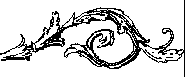
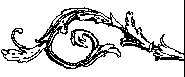
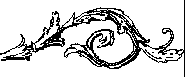
Von der Kunst, Acrylfarben zu machen
Die Pigmente werden, falls erforderlich, im Mörser zerkleinert und gemahlen. Liegen harte und grobkörnige Pigmente vor (wie etwa sandige Ocker oder Ägyptischblau), kann das ein mühsamer Prozeß sein. Industriell hergestellte Pigmente sind dagegen feiner, als sie ein Normalmensch im Mörser von Hand reiben kann, also kann man sie direkt verwenden.
Die Pigmente werden mit etwas Wasser angeteigt und angerieben. Ziel ist eine steife Paste, zuviel Wasser würde die Farbe zu dünn machen, ohne Wasser besteht die Gefahr, daß die Acryldispersion koaguliert, indem die Pigmentoberfläche das Wasser der Dispersion oberflächlich bindet (das kann besonders leicht bei tonigen Erdfarben passieren). Hat man sehr farbintensive, feine Pigmente vorliegen (Beispiele: die meisten modernen, organischen Pigmente wie etwa Phtalocyanine ("Heliogenblau"), aber auch traditionelle Pigmente wie Preußischblau und Ruß), so sollten sie mit einem "Füllstoff" zusammen angerieben werden. Solche "Füllstoffe" sind mineralische Pulver ohne eigene Färbung, beispielsweise Kreide, Schwerspat oder Quarzmehl. Sie "verdünnen" die (manchmal auch sehr teuren) Pigmente nicht nur, sie verleihen der Farbe mehr Körper und Griffigkeit, und sie bringen die Farbigkeit der intensiv färbenden Pigmente erst richtig zu Entfaltung. Derartige stark färbende organische Industriepigmente anzureiben, ist ohnehin eine Kunst für sich. Sie erfordern meistens die Zugabe von Netzmitteln. Man geht zweckmäßigerweise so vor: Zunächst das Pigment mit etwas Netzmittel und Wasser unter dem Läufer dispergieren, dann nach und nach den Füllstoff mit weiterem Wasser zusetzen, bis eine gleichmäßig gefärbte, homogene, steife Paste entstanden ist. Die Menge des Fülstoffes richtet sich nach der Färbekraft des Pigmentes, sie liegt bei organischen Pigmenten in der Regel bei 10:1 (Relation Füllstoff/Pigment)
Erst wenn die Pigmente gut mit Wasser benetzt sind, und ggf. zur Homogenisierung unter einem Glasläufer dispergiert sind, werden sie mit dem Acrylbinder versetzt.
Art und Menge des Acrylbinders richten sich nach den gewünschten Eigenschaften der Farbe.
Wenig Binder (nicht unter 20% bezogen auf Farbpaste) macht die Farbe matt, aber auch spröde (etwa wie Leimfarbe). Die Pigmente wirken nach Trocknung der Farbe dann in ihrem ursprünglichen, trockenen Erscheinungsbild.
 |
Links: Aufstriche natürlicher Erdfarben. Nur schwach gebunden (ca. 25% Binder, bezogen auf Pigmentteig). Die Farben stehen matt, die Struktur der Pigmente (Rot- und Gelbocker) ist gut sichtbar. Hier handelt es sich um selbstgesammelte Farben, die noch grobe Teilchen (Sand etc) enthalten.. |
Viel Acrylbinder (z.B. 2-3 Teile Binder, ein Teil Pigmentpaste) läßt klassische "Acrylfarben" entstehen. Lasurpigmente entfalten dann ihre Lasurwirkung, die Farben werden "satter", ölfarbenähnlich. Verwendet man zum Binden die "Acrylmalbutter" (Rezept s. oben) so lassen sich gute, pastenförmige Farben herstellen, wie sie auch als "Tubenfarben" von den Künstlerfarbenherstellern angeboten werden.
|
|
Links: Ausschnitt aus einer Fläche, bemalt mit gelbem Ocker und Ägyptischblau. Für das Ägyptischblau wurde die verdickte Acrylpaste verwendet; der Ocker ist mit einer größeren Menge Binder angerieben. Die Farbe ist satt und lasierend, aber sie glänzt auch. |
Die mit viel Binder hergestellten Farben sind flexibel und reißen auch bei dickem Farbauftrag nicht. Sie eignen sich auch zum Malen auf flexiblen Bildträgern (z.B. Leinwand). Den pastenförmigen Binder sollten man immer nehmen, wenn man grobe, sandartige Pigmente binden will, denn der strukturviskose Binder verhindert das Absetzen der groben Teilchen.
Auch hier gilt wieder: Wenn man sich nicht sicher ist, Bindeprobe machen, wie ich bei den Grundierungsmassen geschrieben habe.
![]()